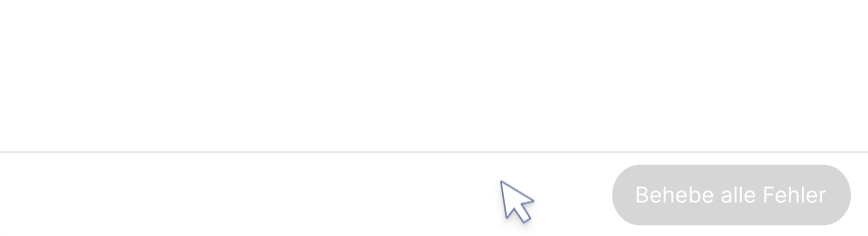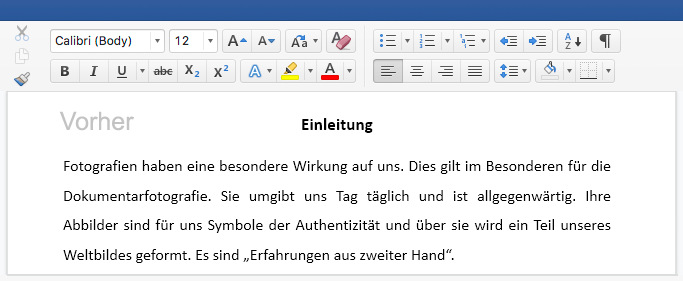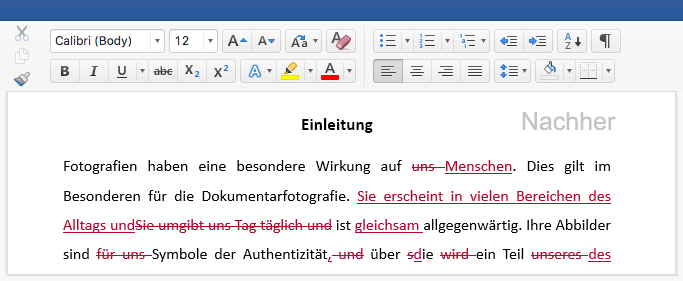Literaturverzeichnis Chicago: Fuß- oder Endnotensystem
Nach dem Fuß- oder Endnotensystem der Chicago-Zitierweise gibt es verschiedene Möglichkeiten, die verwendeten Quellen am Ende einer Arbeit aufzuführen. Häufig verwendet werden
- das Literaturverzeichnis,
- die Bibliographie und
- das kommentierte Literaturverzeichnis.
Im Literaturverzeichnis werden die Quellen aufgeführt, die du in deiner Arbeit zitiert oder paraphrasiert hast.
In einer Bibliographie nennst du auch Quellen, die du in deiner Recherche lediglich gelesen hast.
In einer kommentierten Bibliographie nennst du ebenfalls Quellen, die du in deiner Recherche lediglich gelesen hast. Zusätzlich beschreibst du die einzelnen Quellen kurz unter der jeweiligen Quellenangabe.
An deutschen Universitäten ist das Literaturverzeichnis am gebräuchlichsten.
Quellenangaben in Literaturverzeichnis und (kommentierter) Bibliographie
Nach dem Fuß- oder Endnotensystem der Chicago-Zitierweise unterscheiden sich die Quellenangaben im Literaturverzeichnis und in einer Bibliographie nicht in ihrer Formatierung, sondern nur in ihrer Auswahl.
- Literaturverzeichnis: Nur zitierte und paraphrasierte Quellen anführen
- Bibliographie: Auch nur gelesene Quellen anführen
…
In einer kommentierten Bibliographie wird die Quelle unter der Quellenangabe kurz beschrieben.
Die Beschreibung kann eine kurze sachliche Zusammenfassung, aber auch eine Evaluation der Quelle enthalten. Sowohl kurze Beschreibungen in eckigen Klammern als auch längere Beschreibungen im Fließtext sind möglich.
Elsen, Hilke. „Neologismen in der Jugendsprache.“ Muttersprache: Vierteljahresschrift für deutsche Sprache 112, Nr. 2 (November 2020): 136–54. DOI:10.5282/ubm/epub.14557.
[ein Fachzeitschriftenartikel über Neologismen in der Jugendsprache, Funktionen und Motive für die Bildung und Verwendung neuer Wörter]
oder
Zusammenfassung im Fließtext
Elsen, Hilke. „Neologismen in der Jugendsprache.“ Muttersprache: Vierteljahersschrift für deutsche Sprache 112, Nr. 2 (November 2020): 136–54. DOI:10.5282/ubm/epub.14557.
In diesem Fachzeitschriftenartikel werden Neologismen in der Jugendsprache, ihre Funktionen und Motive für die Bildung und Verwendung neuer Wörter beschrieben.
oder
Zusammenfassung und Evaluation
Elsen, Hilke. „Neologismen in der Jugendsprache.“ Muttersprache: Vierteljahersschrift für deutsche Sprache 112, Nr. 2 (November 2020): 136–54. DOI:10.5282/ubm/epub.14557.
In diesem Fachzeitschriftenartikel werden Neologismen in der Jugendsprache, ihre Funktionen und Motive für die Bildung und Verwendung neuer Wörter beschrieben. Der Artikel enthält relevante Thesen über Funktionen von Neologismen in der Jugendsprache. An einigen Stellen könnte die Analyse der Motive für die Bildung neuer Wörter jedoch differenzierter ausfallen.
Buchquellen und Fachzeitschriften werden in den drei Verzeichnissen grundsätzlich aufgeführt.
Einige Quellenarten listest du jedoch nur auf, wenn
- du sie mehrfach zitierst,
- sie grundlegend für eines deiner Argumente sind oder
- an deiner Universität gefordert wird, sie aufzuführen.
Zu diesen Quellenarten gehören:
- Internetquellen z. B. Internetseiten, Blogs oder YouTube-Videos,
- Zeitungsartikel,
- Abstracts und Reviews,
- einzelne Dokumente eines Manuskripts,
- die Bibel,
- Wörterbücher und Lexika sowie
- Abbildungen.
So erstellst du das Literaturverzeichnis und die Bibliographie nach Chicago
Im Literaturverzeichnis und in der Bibliographie werden die Quellenangaben vollständig und in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
Die Formatierung der Quellenangaben ist für das Literaturverzeichnis und die Bibliographie gleich.
Die einzelnen Quellenangaben rückst du nach der Chicago-Zitierweise ab der zweiten Zeile ein.
| Teil der Quellenangabe | Korrekte Formatierung |
|---|---|
| Titel selbstständiger Publikationen | Titel selbstständiger Publikationen setzt du kursiv, z. B.
|
| Titel unselbstständiger Publikationen | Titel unselbstständiger Publikationen setzt du in Anführungszeichen, z. B.
|
| Titel und Untertitel | Folgt ein Untertitel nach dem Titel, setzt du dazwischen einen Doppelpunkt:
Titel: Untertitel |
| Anordnung der Namen | Erste verfassende Person: Nachname, Vorname Alle weiteren verfassenden Personen: Beispiel |
| Vornamen | Vornamen werden ausgeschrieben, zweite Vornamen werden abgekürzt.
Beispiel |
| Viele Verfassende | Im Literaturverzeichnis werden bis zu zehn Verfassende namentlich aufgeführt.
Bei mehr als zehn Verfassenden führst du die ersten sieben namentlich auf, gefolgt von der Abkürzung et al. |
| Schreibweise des Datums | Die Schreibweise eines Datums unterscheidet sich im Deutschen von den Angaben im Chicago Manual of Style.
An deutschen Universitäten verwendet man:
In den USA verwendet man:
|
| Schreibweise der Seitenzahlen | Bei Seitenangaben kann die Zehner- und Hunderterstelle der zweiten Seitenzahl weggelassen werden:
183–7 statt 183–187. |
Buchquellen angeben
Zitierst du Buchquellen, unterscheidest du zwischen Monographien und Sammelbänden.
Monographie in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. Buchtitel: Untertitel. Verlagsort: Verlag, Jahr.
Beispiel:
Busch, Frederik und Katrin Meinhardt. Akademische Tendenzen in Deutschland. Stuttgart: Dahlhaus Verlag, 2022.
Kapitel eines Sammelbands in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. „Titel des Kapitels.“ In Buchtitel: Untertitel, herausgegeben von Vorname Nachname, Seitenangaben. Verlagsort: Verlag, Jahr.
Beispiel:
Thiel, Christian und Andreas Bernardi. „Training motorischer Hauptbeanspruchungsformen.“ In Körperliche Aktivität und Gesundheit, herausgegeben von Winfried Banzer, 19–34. Berlin: Springer, 2017.
Internetquellen angeben
Internetquellen können zum Beispiel eine Internetseite oder YouTube sein. Du solltest immer überprüfen, ob deine Quelle zitierwürdig ist (siehe Quellenkritik).
Internetseite in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. „Titel des Textes oder des Artikels.“ Titel der Internetseite. Datum. DOI/URL.
Beispiel:
Heinemeyer, Annika. „Die 10 wichtigsten Zitierregeln für deine wissenschaftliche Arbeit.“ Scribbr. Aktualisiert am 02.09.2022. https://www.scribbr.de/richtig-zitieren/zitierregeln/.
YouTube-Video in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. „Titel des Videos.“ Zusätzliche Informationen. Tag. Monat. Jahr. Format, Länge des Videos. URL.
Beispiel:
Weinhardt, Mirjam. „Literaturverzeichnis erstellen und formatieren.“ Scribbr. 09.12.2020. Lehrvideo, 4:13. https://www.youtube.com/watch?v=DGltnE5pWuA.
Wusstest du schon, dass ...
Scribbr durchschnittlich 150 Fehler pro 1000 Wörter korrigiert?
Unsere Sprachexperten verbessern vor Abgabe deiner Abschlussarbeit den akademischen Ausdruck, die Interpunktion und sprachliche Fehler.
Fachzeitschriften und Zeitungen angeben
Fachzeitschriften (Journals) sind als wissenschaftliche Quellen zitierwürdig.
Da Zeitungsartikel oft nicht wissenschaftlich sind, solltest du abklären, ob du sie für deine Arbeit verwenden darfst (siehe Quellenkritik).
Fachzeitschriften in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. „Titel des Artikels.“ Titel der Zeitschrift Bandnummer, Nr. Heftnummer (Monat und Jahr): Seitenzahlen. Ggf. DOI/URL.
Beispiel:
Elsen, Hilke. „Neologismen in der Jugendsprache.“ Muttersprache: Vierteljahersschrift für deutsche Sprache 112, Nr. 2 (November 2020): 136–54. DOI:10.5282/ubm/epub.14557.
Zeitungsartikel in Literaturverzeichnis und Bibliographie angeben
Nachname, Vorname. „Titel des Artikels.“ Titel der Zeitung, Tag. Monat. Jahr.
Beispiel Artikel in gedruckter Form:
Rodemann, Julian. „Chemie-Nobelpreis geht an zwei Genforscherinnen.“ Süddeutsche Zeitung, 07.10.2020.
Format Onlineartikel:
Nachname, Vorname. „Titel des Artikels“ Name der Zeitung, Tag. Monat. Jahr. URL.
Beispiel Onlineartikel:
Dribbusch, Barbara. „Viele Azubi-Plätze unbesetzt.“ TAZ, 18.08.2022. https://taz.de/Drastischer-Nachwuchsmangel-in-Betrieben/!5872152/.
Abbildungen angeben
Abbildungen können zum Beispiel Onlineabbildungen oder aus einem Buch entnommene Bilder oder Grafiken sein.
Nachname, Vorname. Titel der Abbildung. Jahr. In Vorname Nachname, Titel des Buches, Seitenangaben. Stadt: Verlag, Jahr.
Beispiel Abbildung aus einem Buch:
Voll, Markus und Karl Wesker. Mm. pectoralis major und coracobrachialis. 2007. In Michael Schünke, Erik Schulte und Udo Schumacher, Prometheus: LernAtlas der Anatomie. 2. Auflage, 303. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2007.
Format Onlineabbildung:
Nachname, Vorname. Titel der Abbildung. Beschreibung des Formats. Titel der Internetseite. Tag. Monat. Jahr. URL.
Beispiel Onlineabbildung:
Bachmann, Hannah. Beispiel Abbildungsverzeichnis. Abbildung. Scribbr. 01.02.2022. https://www.scribbr.de/aufbau-und-gliederung/abbildungsverzeichnis-bachelorarbeit/.
Abbildungen werden oft zusätzlich in einem Abbildungsverzeichnis aufgeführt. Dabei können die Vorgaben variieren. Sprich mit deiner Betreuungsperson, wenn du dir unsicher bist, ob du ein Abbildungsverzeichnis anlegen sollst.
Häufig gestellte Fragen
Quellen für diesen Artikel
Wir empfehlen Studierenden nachdrücklich, Quellen in ihrer Arbeit zu verwenden. Du kannst unseren Artikel zitieren oder dir mit den Artikeln weiter unten einen tieferen Einblick verschaffen.
Diesen Scribbr-Artikel zitierenGlöckler, L. (2022, 15. November). Literaturverzeichnis Chicago: Fuß- oder Endnotensystem. Scribbr. Abgerufen am 14. April 2025, von https://www.scribbr.de/chicago-zitierweise/chicago-literaturverzeichnis-fuss-oder-endnotensystem/
PH Zürich. (n.d.). Wissenschaftlich zitieren: Literatur und Quellen dokumentieren nach dem Chicago Manual of Style. In https://phzh.ch/. https://stud.phzh.ch/globalassets/stud.phzh.ch/dienstleistungen/schreibzentrum/chicago-style_infoblatt.pdf
The Chicago Manual of Style, 17th Edition. (n.d.). The Chicago Manual of Style Online. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html